Freiburg
Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht über die internationalen Wirtschaftsbeziehungen geredet wird. Von Deglobalisierung ist die Rede, von einer Rückverlagerung von Produktion nach Europa, von der Souveränität Europas insbesondere handelspolitisch, von einem Schutz vor Direktinvestitionen in sicherheitsrelevanten Bereichen, subtiler noch: von «fairem» Handel oder friend-shoring, dem Handel mit befreundeten Staaten.
Das Ende der Globalisierung – so oder so ähnlich lässt sich der Tenor dieser Diskussionen zusammenfassen. Dabei war nach dem Fall des Eisernen Vorhangs vor dreissig Jahren noch vom Ende der Geschichte die Rede. Löst eine neue Übertreibung die al ...
Dies ist ein ABO-Artikel
Jetzt für EUR 5.- im ersten Monat abonnieren
Nur für Neukunden, danach EUR 17.-/Monat und jederzeit kündbar.
Oder einfach einloggen…
Wenn Sie als Nicht-Abonnent noch keinen Account besitzen,
registrieren Sie sich jetzt und Sie können 5 Abo-Artikel gratis lesen.
Wenn Sie als Abonnent noch keinen Account besitzen,
registrieren Sie sich jetzt und Sie können sämtliche Artikel lesen.
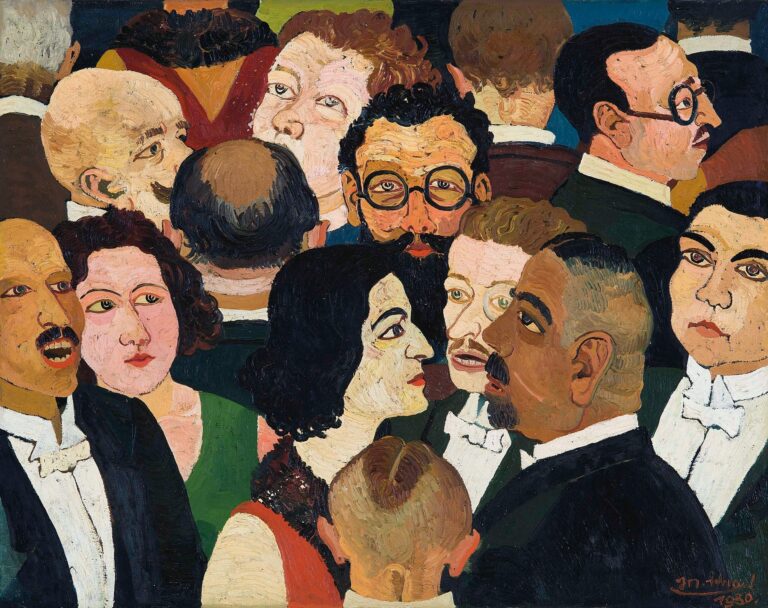
Firmen aus den USA werden absehbar keine gleichberechtigten Verträge mit Firmen aus anderen Ländern abschliessen. Zwei Beispiele aus eigenem Erleben. Ein Vertrag meiner Firma mit einem US-Amerikanischen Konzerns (Apple) scheiterte an der Feststellung des US-Konzerns: "Not invented here!". In ein anderer Fall betraf die Unterhaltungs-Industrie. Der Künstler wollte nicht von Italien in die USA umziehen. Also war das Geschäft gestorben.
Ich halte den Artikel für eine Aufwärmung längst vergangenem. Deutschland spielt globalistisch und weltwirtschaftlich eine immer kleinere Rolle, da die wichtigste Voraussetzung fehlt: günstige Energie. In der wirtschaftlichen Entwicklung bremst am meisten die totale Zerlegung in ein Fachidiotentum, dem der Blick für das große Ganze fehlt. Man das auch als Logistik mit Verantwortung sehen. Das beherrschten aber die Generationen, die Deutschland nach dem 2. WK wieder aufgebaut haben.